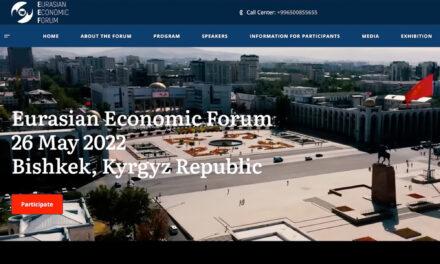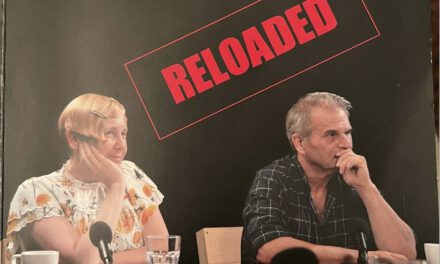Das Versagen der Justiz
Die Judikative verschwand im Corona-Schützengraben
von Wolfgang Jeschke
Ist es gerechtfertigt, den Juristen an den Gerichten vorzuwerfen, sie hätten erst gar nicht, dann zu zögerlich reagiert, als die Exekutive mit drakonischen Maßnahmen die Zerstörung der Gesellschaft in Angriff nahm? Darf man Richtern, die selbst auch „nur“ Menschen sind, nicht zugestehen, dass die mediale Wucht, mit der Corona über uns gebracht wurde, nicht auch sie verstummen lassen durfte? Oder hätten wir erwarten müssen, dass die Verwaltungs- und Verfassungsgerichte in Anbetracht der monumentalen Eingriffe in die Grundrechte die angewendeten Normen und die Art ihrer Anwendung hätten überprüfen oder im Zweifel ein Normenkontrollverfahren beim Bundesverfassungsgericht einleiten müssen?
Verunsicherung: Was menschlich vielleicht verständlich sein könnte, ist es juristisch aber nicht. Die Gewaltenteilung ist eines der zentralen Elemente unserer demokratischen Gesellschaft. Nach Ausrufung des Seuchennotstands war die Gewaltenteilung in wesentlichen Bereichen aufgehoben, weil nunmehr die Exekutive über Verordnungen und nicht mehr die vom Volk gewählten Parlamentarier – die Legislative – über Gesetze die Geschicke des Landes und der Länder bestimmten. Die neue Regierungsform beschreibt die Bundesregierung selbst als „das kleine und das große Corona-Kabinett“ (1) – eine Regierungsform, welche die Verfassung nicht kennt. Ebenso wenig kennt die Verfassung einen pseudoföderalen Staatsrat, der mit Kanzlerin und Ministerpräsidenten besetzt ist und Entscheidungen über das gesamte Volk, seine Gesundheit und sein Vermögen trifft. In dieser Situation war der Schutz der Bevölkerung vor Grundrechtsverletzungen durch die Anwendung der Notstandsverordnungen nicht mehr gegeben – die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der Maßnahmen der Exekutive lag ausschließlich in der Hand der Gerichte. Sie waren und sind die letzte Bastion des Rechtsstaates gegen eine mit Übermaß und Unverhältnismäßigkeit regierende Exekutive.
Das Infektionsschutzgesetz beendet die Gewaltenteilung
Das Infektionsschutzgesetz ist ein Gesetz für kurzfristige Notlagen. Es soll die Handlungsgeschwindigkeit erhöhen, welche in einer echten Krise möglicherweise mit debattierenden Parlamenten nicht erreicht werden könnte. Eine solche Notlage hat es aber zu keinem Zeitpunkt gegeben, wie die tatsächlichen Ereignisse zeigen. Die Feststellung und Aufrechterhaltung der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ hatte zu keinem Zeitpunkt eine verfassungsrechtlich tragbare Begründung, selbst wenn man geneigt wäre, den nicht sachkompetenten Politikern hier eine Panikreaktion zuzugestehen – was allerdings ihren Anspruch auf „Verantwortung“ zweifelhaft erscheinen lässt. Seit März nun leben wir unter dem Notstandsgesetz ohne Notstand und die Judikative schaut zu.
Das Versagen der Justiz geschah auf vielen verschiedenen Ebenen. Viele Unternehmen und Bürger, die sich mit Klagen an die Gerichte wandten, erlebten in den Entscheidungen der Gerichte eine Umkehr der Beweislast: Nicht der Staat wurde von den Gerichten gezwungen, die Begründung für Grundrechtsverstöße anhand einer objektiven Gefährdungslage nachzuweisen und die Entscheidungsgrundlagen offenzulegen. In den Entscheidungen der Gerichte formulierten diese Sätze wie: „Es ist offensichtlich, dass die Öffentlichkeit, aber auch das soziale bzw. geschäftliche Umfeld der Klägerin die Schließung ihres Betriebes als – aus Sicht der Behörden – zwingende Maßnahme zur Eindämmung des Infektionsrisikos verbinden.“ Die gefühlte Offensichtlichkeit der Gefährdung hatte keine belastbare Grundlage – jenseits der Hypothesen des Robert-Koch-Institutes, das eine nachgeordnete Einrichtung des Bundesgesundheitsministeriums ist und damit eine Institution, die weisungsgebunden zum unmittelbaren Einflussbereich des Verordnungsgebers und zentralen Ausführungsorgan des Infektionsschutzgesetzes ist. Die Maßnahmen des Verordnungsgebers mit den Begründungen des Verordnungsgebers zu begründen, ist de facto keine Überprüfung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen.
Grundrechtseinschränkungen – die Gerichte verzichten auf Prüfung der Verfassungsmäßigkeit
Die gerichtliche Behauptung einer „Offensichtlichkeit aus der Sicht der Behörden“ (die Verordnungsgeber sind) ersetzt selbstverständlich nicht die Sachverhaltsprüfung. Sie führt im Gegenteil das Rechtssystem ad absurdum. Denn das Gericht macht sich damit die Entscheidung der Exekutive, gegen die ja gerade geklagt wurde, zueigen und zur Grundlage der eigenen Urteilsfindung. Im Zweifel hätten die Gerichte ein Normenkontrollverfahren anstrengen können. Das taten sie aber nicht.
Beim zweiten Lockdown wurde das Versagen der Gerichte noch offensichtlicher: Obwohl selbst das RKI feststellte, dass von der Gastronomie, Gesundheits-, Sport- und Kultureinrichtungen kein relevantes Risiko ausgeht, wurden diese Betriebe geschlossen, Klagen der Betreiber überwiegend abgewiesen.
Wenn der Staat in die Rechte seiner Bürger eingreift, muss es eine differenzierte Begründung und Abwägung geben. Die Eingriffe müssen erforderlich, geeignet und verhältnismäßig sein. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip als Teil des Rechtsstaatsprinzips verlangt zwingend, dass staatliche Eingriffe geeignet sein müssen, das angestrebte Ziel zu erreichen oder zu fördern; der Eingriff ist nur erforderlich, wenn kein milderes, den Betroffenen oder Dritte weniger belastendes Mittel zur Verfügung steht, das den Zweck ebenso gut zu fördern vermag; ein geeigneter und erforderlicher Eingriff darf dennoch nicht vorgenommen werden, wenn der damit verbundene Schaden in grobem Missverhältnis zu dem angestrebten Zweck steht. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip setzt dem Handeln aller öffentlicher Gewalt, auch der Gesetzgebung, Grenzen.
Verhältnismäßigkeitsprinzip ist Teil des Rechtsstaatsprinzips
Was also hätten die Gerichte zu tun? Sie hätten es auf sich nehmen müssen, den Sachverhalt zu erforschen. Das heißt konkret: Sie hätten die Argumente und deren Grundlagen überprüfen müssen, auf denen die Grundrechtseinschränkungen, die Freiheitsberaubungen, die Körperverletzungen und die Zerstörung wirtschaftlicher Existenzen von Millionen Menschen erfolgte. „Wie sollen Richter denn beurteilen, ob Sars-CoV-2 gefährlich ist – oder eben nicht? Wie soll ein Richter beurteilen können, ob die Maßnahmen geeignet sind oder der Schaden größer ist als der Nutzen?“
Wenn die Judikative sich nicht in der Lage sieht, die Sachverhalte durch Hinzuziehung von externer Expertise zu ermitteln und dadurch die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen zu prüfen, ist die Judikative als Staatsgewalt im Kanon der Gewaltenteilung nutzlos, weil wirkungslos. Im Verhältnis zwischen Exekutive und Souverän, zwischen Staatsmachtinhabern und Staatsvolksmitgliedern als Grundrechtsträger muss die Judikative sicherstellen, dass die Regelungen dem Übermaßverbot entsprechen. Die Grundhaltung, die sich in der Corona-Krise in den meisten Urteilen ausmachen lässt, akzeptierte aber die medial dramatisierte Lage und schuf damit ein Vor-Urteil in den Köpfen der Richter.
Insbesondere die Lockdowns und Kontaktverbote verletzen die Grundrechte der Menschen auf vielfältige Weise und lösen seelische, gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden aus. Die Begründung war immer wieder die gleiche: Eine sich rasant ausbreitenden COVID-19-Erkrankung und die damit verbundenen katastrophischen Visionen, die von Medien und Politikern in einem unaufhörlichen Stakkato auf die Gesellschaft gefeuert wurden. Die „Faktenleugnung“ der Gerichte – um einmal ein negatives Framing der Maßnahmenverordner zu verwenden – schuf erst die Grundlage für den Verordnungsexzess, in dem sich die Exekutive der Länder und die Exekutive im Bund gegenseitig überboten, weil es offenbar in unserem Land für Wählerzuspruch sorgt, wenn man dem Volk Fesseln anlegt, die Koalitionsfreiheit beendet und Maulkörbe verpasst. Denn zu keinem Zeitpunkt breitete sich „die Krankheit“ aus – es waren stets nur positive PCR-Testergebnisse, wie die Sterbefallzahlen belegen.
Wann darf das IfSG angewendet werden?
Man vergegenwärtige sich die beiden Säulen der Corona-Krise: 1. gefährlicher Erreger + 2. Krankheitsverbreitung in der Bevölkerung, nachgewiesen durch PCR-Tests. Diese beiden Säulen hätten die Gerichte überprüfen können, hätten sie überprüfen müssen. Schon diese Überprüfung hätte im März ergeben, dass der Erreger kein Killervirus ist und dass die PCR-Tests nicht einmal technisch geeignet sind, eine Infektion nachzuweisen, die zu Krankheit und Ansteckung anderer führt. Jegliches Wissen über diese beiden Säulen war in ausreichender Dichte vorhanden.
Die Gerichte unternahmen aber nicht einmal den Versuch, diese Prüfung vorzunehmen. Doch nur diese Überprüfung hätte die Grundlage für die Beurteilung des tatsächlichen Risikos geschaffen und damit den Maßstab, an welchem die Gerichte wiederum die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen hätten überprüfen können. Zu deutsch: Wie groß ist die Gefahr? Sind die Maßnahmen erforderlich, geeignet und verhältnismäßig? Wenn die Gerichte darauf verzichten, das Rechtsstaatsprinzip anzuwenden, dessen wesentlicher Kern auch im Verhältnismäßigkeitsprinzip lebt, ist der Rechtsstaat am Ende.
Das Infektionsschutzgesetz (IfSG) (2) definiert eine Infektion in § 2, Absatz 2 wie folgt: „Infektion (ist) die Aufnahme eines Krankheitserregers und seine nachfolgende Entwicklung oder Vermehrung im menschlichen Organismus.“ Der Nachweis einer Infektion im Sinne des IfSGs wird aber nicht erbracht, wenn dies mit Hilfe von PCR-, Antigen- oder Antikörpertests erfolgt, da keines dieser Verfahren in der Lage ist, ein lebendiges oder vermehrungsfähiges Virus nachzuweisen. Dies kann nur die Anzucht eines Erregers in Zellkultur. Eine einfache Überprüfung der Begründung der Maßnahmen hätte offenbart, dass hohe Zahlen von positiven PCR-Tests keine Aussage über Ansteckungsrisiken oder die Krankheitsverbreitung zulassen und damit der ausgerufene Notstand mit all seinen schädlichen Folgen unbegründet war und ist. Vor dem zweiten Lockdown im November wiesen Tausende Mediziner auf diese Tatsache hin – die Gerichte ignorierten sie jedoch standhaft und winkten den Lockdown überwiegend unbeeindruckt von wissenschaftlichen Tatsachen durch.
Grundrechte oder die Krümmung der Salatgurke
Wäre es in den vielen Klagen vor den Gerichten um die Frage gegangen, welche Krümmung eine EU-Norm-konforme Salatgurke haben darf, hätte man vielleicht verstehen können, dass die Gerichte sich nicht sonderlich ins Zeug legten. In Anbetracht der Dimension der definitiven Schadensfolgen der Verordnungen für Leib, Leben und wirtschaftliche Existenz und die Einschränkung unveräußerlicher Menschen(Grund-)rechte, ist die Kritik an den Gerichten berechtigt. Sie haben mit ihrem Versagen die Krise erst möglich gemacht und wurden damit Teil der größten gesellschaftlichen Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg.
Als Nächstes werden die Auswirkungen der zahllosen Änderungen des IfSGs vor den Gerichten landen, mit denen die Exekutive die Grundrechte der Menschen weiter beschneidet, die Selbstermächtigung ausweitet, der Exekutive noch weiter gehende Rechte zuweist, den Föderalismus durch Ausschaltung des Bundesrates einschränkt, die Entschädigungsregelungen bei Impfschäden verschlechtert, einen mittelbaren Impfzwang einführt und vieles mehr. Interessant sind auch die vielen Änderungen, die bereits vor der Ausrufung der Pandemie erfolgten (3). Die Änderungen des IfSGs seit Ende 2019 (4) sind ein ganzes Buffet juristischer Leckereien für alle grundrechtsorientierten Juristen – seien es Anwälte oder Richter.
Quellen:
(1) https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/regierungshandeln-covid19-1740548
(2) https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__2.html
(3) https://www.buzer.de/1_Masernschutzgesetz.htm
(4) https://www.buzer.de/gesetz/2148/l.htm