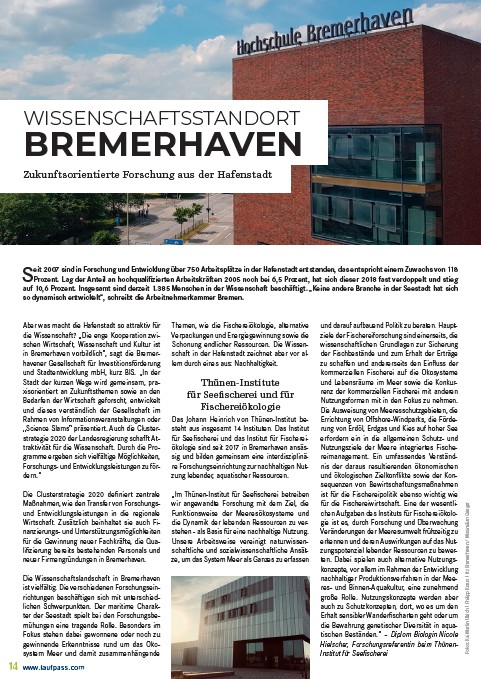
Seit 2007 sind in Forschung und Entwicklung über 750 Arbeitsplätze in der Hafenstadt entstanden, das entspricht einem Zuwachs von 118
Prozent. Lag der Anteil an hochqualifizierten Arbeitskräften 2005 noch bei 6,5 Prozent, hat sich dieser 2018 fast verdoppelt und stieg
auf 10,6 Prozent. Insgesamt sind derzeit 1.385 Menschen in der Wissenschaft beschäftigt. „Keine andere Branche in der Seestadt hat sich
so dynamisch entwickelt“, schreibt die Arbeitnehmerkammer Bremen.
Aber was macht die Hafenstadt so attraktiv für
die Wissenschaft? „Die enge Kooperation zwischen
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur ist
in Bremerhaven vorbildlich“, sagt die Bremerhavener
Gesellschaft für Investitionsförderung
und Stadtentwicklung mbH, kurz BIS. „In der
Stadt der kurzen Wege wird gemeinsam, praxisorientiert
an Zukunftsthemen sowie an den
Bedarfen der Wirtschaft geforscht, entwickelt
und dieses verständlich der Gesellschaft im
Rahmen von Informationsveranstaltungen oder
„Science Slams“ präsentiert. Auch die Clusterstrategie
2020 der Landesregierung schafft Attraktivität
für die Wissenschaft. Durch die Programme
ergeben sich vielfältige Möglichkeiten,
Forschungs- und Entwicklungsleistungen zu fördern.“
Die Clusterstrategie 2020 definiert zentrale
Maßnahmen, wie den Transfer von Forschungs-
und Entwicklungsleistungen in die regionale
Wirtschaft. Zusätzlich beinhaltet sie auch Finanzierungs
und Unterstützungsmöglichkeiten
für die Gewinnung neuer Fachkräfte, die Qualifizierung
bereits bestehenden Personals und
neuer Firmengründungen in Bremerhaven.
Die Wissenschaftslandschaft in Bremerhaven
ist vielfältig. Die verschiedenen Forschungseinrichtungen
beschäftigen sich mit unterschiedlichen
Schwerpunkten. Der maritime Charakter
der Seestadt spielt bei den Forschungsbemühungen
eine tragende Rolle. Besonders im
Fokus stehen dabei gewonnene oder noch zu
gewinnende Erkenntnisse rund um das Ökosystem
Meer und damit zusammenhängende
Themen, wie die Fischereiökologie, alternative
Verpackungen und Energiegewinnung sowie die
Schonung endlicher Ressourcen. Die Wissenschaft
in der Hafenstadt zeichnet aber vor allem
durch eines aus: Nachhaltigkeit.
Thünen-Institute
für Seefischerei und für
Fischereiökologie
Das Johann Heinrich von Thünen-Institut besteht
aus insgesamt 14 Instituten. Das Institut
für Seefischerei und das Institut für Fischereiökologie
sind seit 2017 in Bremerhaven ansässig
und bilden gemeinsam eine interdisziplinäre
Forschungseinrichtung zur nachhaltigen Nutzung
lebender, aquatischer Ressourcen.
„Im Thünen-Institut für Seefischerei betreiben
wir angewandte Forschung mit dem Ziel, die
Funktionsweise der Meeresökosysteme und
die Dynamik der lebenden Ressourcen zu verstehen
- als Basis für eine nachhaltige Nutzung.
Unsere Arbeitsweise vereinigt naturwissenschaftliche
und sozialwissenschaftliche Ansätze,
um das System Meer als Ganzes zu erfassen
und darauf aufbauend Politik zu beraten. Hauptziele
der Fischereiforschung sind einerseits, die
wissenschaftlichen Grundlagen zur Sicherung
der Fischbestände und zum Erhalt der Erträge
zu schaffen und andererseits den Einfluss der
kommerziellen Fischerei auf die Ökosysteme
und Lebensräume im Meer sowie die Konkurrenz
der kommerziellen Fischerei mit anderen
Nutzungsformen mit in den Fokus zu nehmen.
Die Ausweisung von Meeresschutzgebieten, die
Errichtung von Offshore-Windparks, die Förderung
von Erdöl, Erdgas und Kies auf hoher See
erfordern ein in die allgemeinen Schutz- und
Nutzungsziele der Meere integriertes Fischereimanagement.
Ein umfassendes Verständnis
der daraus resultierenden ökonomischen
und ökologischen Zielkonflikte sowie der Konsequenzen
von Bewirtschaftungsmaßnahmen
ist für die Fischereipolitik ebenso wichtig wie
für die Fischereiwirtschaft. Eine der wesentlichen
Aufgaben des Instituts für Fischereiökologie
ist es, durch Forschung und Überwachung
Veränderungen der Meeresumwelt frühzeitig zu
erkennen und deren Auswirkungen auf das Nutzungspotenzial
lebender Ressourcen zu bewerten.
Dabei spielen auch alternative Nutzungskonzepte,
vor allem im Rahmen der Entwicklung
nachhaltiger Produktionsverfahren in der Meeres
und Binnen-Aquakultur, eine zunehmend
große Rolle. Nutzungskonzepte werden aber
auch zu Schutzkonzepten, dort, wo es um den
Erhalt sensibler Wanderfischarten geht oder um
die Bewahrung genetischer Diversität in aquatischen
Beständen.“ – Diplom Biologin Nicole
Hielscher, Forschungsreferentin beim Thünen-
Institut für Seefischerei
14 www.laufpass.com
Fotos: Kai Martin Ulrich | Philipp Kraus | ttz Bremerhaven / Maximilian Grieger
WISSENSCHAFTSSTANDORT
BREMERHAVEN
Zukunftsorientierte Forschung aus der Hafenstadt